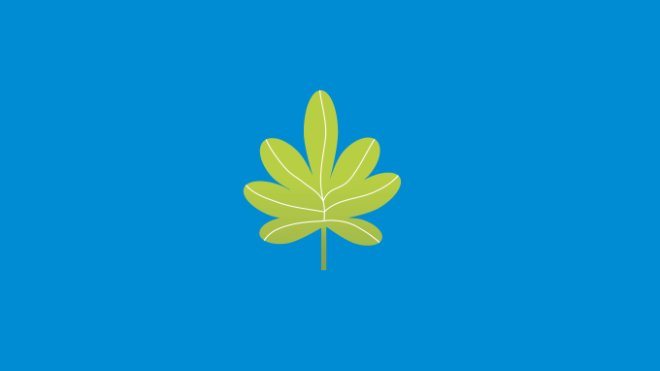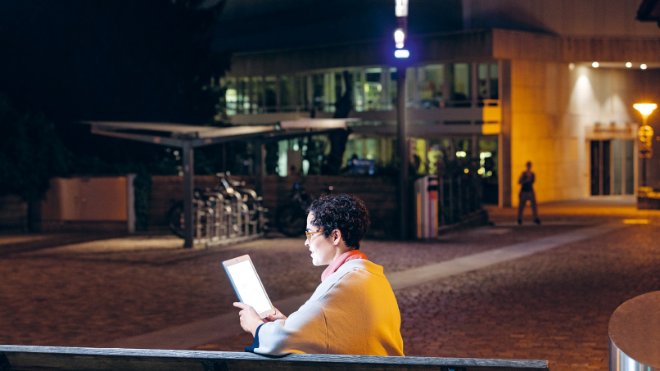Wie fehlerresistent ist die Technologie?
Am Beispiel von Urdorf gesagt: Die Technologie ist nicht mehr oder weniger fehleranfällig als andere moderne Steuerungstechnologien. Die Steuerung wurde in Urdorf zudem so aufgebaut, dass beim Ausfall eines Teilsystems wie beispielsweise der Verkehrsmessung das Licht einfach auf 100% hochfährt. So entsteht zu keiner Zeit ein Sicherheitsrisiko.
Sie kümmern sich als Abteilungsleiter bei EKZ nicht nur um die Beleuchtung, sondern auch um den Bereich Smart City. Könnten sie die Philosophie dahinter kurz zusammenfassen?
Unter einer Smart City versteht man Konzepte, Städte mithilfe technischer Entwicklungen und Informations- und Kommunikationstechnologien zu modernisieren und lebenswerter zu gestalten. Dazu gehört z.B. die nachhaltige Nutzung von Ressourcen, indem Verkehrsflüsse durch intelligente Systeme aufeinander abgestimmt werden oder die Beleuchtung nur bei Bedarf eingesetzt wird. Gemeint ist aber auch die Digitalisierung der Verwaltung. Dies soviel zur Definition.
Welche Projekte setzen sie gerade um?
Neue und spannende Projekte in unserem Bereich sind verschiedene Smart-City-Projekte wie beispielsweise in Dietikon und Wädenswil, wo aktuell umfassende Konzepte auf dem Weg zur intelligenten Stadt umgesetzt werden. Und Richterswil begleiten wir beispielsweise gerade auf dem Weg, eines der ersten «Smart Villages» zu werden. Es gäbe noch ein paar Projekte mehr, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten.
Wo sehen Sie die Hindernisse?
Alle diese Projekte laufen jeweils nicht von heute auf morgen an. Eine fehlende Standardisierung zwischen Leuchten und möglichen Steuerungssystemen war die letzten Jahre der grosse Hemmschuh. Gute technische Lösungen brauchen Zeit - vor allem im Bereich der Infrastruktur, bei der es auch stark um Sicherheit geht, da die Kandelaber ja permanent Wind und Wetter ausgesetzt sind. Das ist nicht ganz trivial und entsprechend sahen wir auch Ansätze, die nicht funktioniert haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir zwischenzeitlich erste gute Lösungen am Markt haben.
Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann gilt es stets auch zu berücksichtigen, dass graue Energie in den Systemen steckt und es manchmal sinnvoller ist, eine bestehende Anlage noch ein paar Jahre weiter zu betreiben. Dabei geht es schliesslich auch um die Wirtschaftlichkeit: Denn bestehende Systeme vor dem Ende ihrer eigentlichen Lebensdauer abzulösen, dafür muss man gute Gründe haben und einen Mehrwert gewinnen. Alles andere wäre Verschwendung öffentlicher Gelder. Deshalb setzen wir viele Projekte entlang ohnehin anstehender Infrastrukturprojekte um. Das braucht halt seine Zeit.
In Bezug auf unsere Kernaufgabe, das Beleuchten, betreiben wir aktuell verschiedene Forschungsprojekte zu Lichtfarben, dies zusammen mit der WSL. Hier geht es wieder ganz grundsätzlich um die Frage: Wie beleuchtet man optimal unter Berücksichtigung aller Aspekte wie Energie, Umwelt, Ästhetik, Komfort und Sicherheit?
Wie ist das Vorgehen, wenn eine Gemeinde auf eine smarte Beleuchtung umrüsten will?
Eine smarte Beleuchtung ist nach meinem Verständnis immer die zu einer Situation bestmögliche passende Beleuchtung. Es benötigt also vor allem ein gutes Verständnis der Situation und eine massgeschneiderte Lösung dafür. Die Komponenten und auch die Systeme, die man dafür benötigt, gibt der Markt heute her. Beschaffen kann diese eigentlich jede Fachperson. Die Kunst liegt meines Erachtens darin, die Anlage sorgfältig zu planen und die richtigen Technologien miteinander zu kombinieren und zu vernetzen. Das ist es, was wir tun. Durch die Standardisierung der Schnittstellen wird diese Entwicklung meines Erachtens noch beschleunigt. Wenn sich jemand interessiert: Wir beraten gerne.
Könnte Zürich in Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen in Bezug auf Smart City?
Der Begriff Smart City ist sehr breit gefasst und umfasst je nach Definition sehr unterschiedliche Themen, welche oft wenig miteinander zu tun haben. Das fängt bei stadtinternen Digitalisierungsprozessen an und geht über Gesundheitsthemen und Infrastruktur bis hin zur Modernisierung der Energieversorgung.
Die Stadt Zürich befindet sich in internationalen Smart-City-Rankings bereits in der Spitzengruppe. Wenn man die Stadt Zürich und den Kanton mit Städten wie Dietikon und Wädenswil, aber auch diversen Gemeinden wie Richterswil betrachtet, um nur einige zu nennen, so stelle ich eine hohe Innovationskraft, verbunden mit einem starken Interesse an diesen Themen, fest. An Tagungen im Ausland sehe ich auch immer wieder, dass wir uns auch mit Themen beschäftigen, die andernorts noch nicht so präsent sind, beispielsweise Steuerungen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung. Wahrscheinlich haben wir dort eine Art Vorreiterstellung.
Wenn man den gesamten Smart-City-Bereich nimmt, sind Städte wie Barcelona, Kopenhagen oder gerade Metropolen in Asien technologisch ein Stück weiter. Ich glaube aber, dass der Grossraum Zürich mit Firmen, Hochschulen, Infrastruktur und guten Rahmenbedingungen eine Vorreiterrolle übernehmen kann – einfach eine Art Schweizer Modell der Smart City.