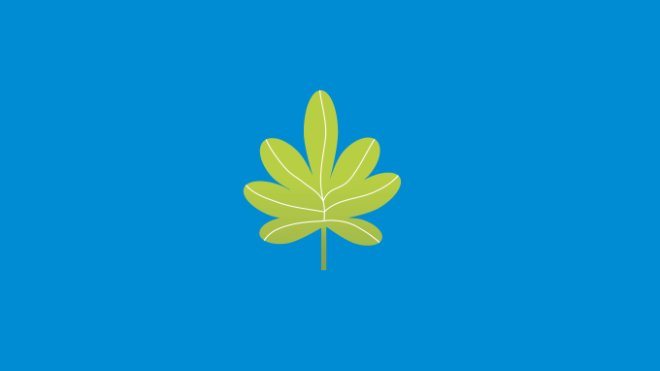Herr Sigrist, Ist Zukunft etwas, das einfach geschieht oder haben wir als Individuen Einfluss darauf?
Wir beeinflussen unsere Zukunft durch unsere Entscheidungen! Jeder Mensch beeinflusst seine eigene Zukunft. Als Gesellschaft bestimmen wir zusammen unser aller Zukunft. Das klingt etwas pathetisch, doch es trifft zu und ist angesichts der weit verbreiteten Vorstellung vom «digitalen Tsunami», der uns alle zu überrollen scheint, wichtiger denn je. Natürlich klingt dies einfacher als es ist, denn wir haben alle mehr Möglichkeiten, mehr Fakten – oder Halbwissen –, die sich zusätzlich laufend verändern. Damit kann nicht jeder umgehen. Viele Menschen brauchen Strukturen, innerhalb derer sie sich bewegen können. Unternehmen, vor allem aber der Staat, sind gefordert, die Entscheidungsfähigkeit der Menschen zu stärken. Denn aus der Überforderung entsteht auch das Risiko einer Entkopplung. Dieswäre gefährlich und einer zukunftsfähigen Gesellschaft nicht zuträglich.
Und wie erforscht man die Zukunft?
Viele Entwicklungen lassen sich nicht prognostizieren. Die Komplexität der Einflussfaktoren, die zu einem bestimmen Ereignis führen, ist oftmals zu hoch. Auch Zufälle spielen eine Rolle. Trotzdem kann man die Zukunft oder mögliche Entwicklungen beschreiben. Die Erforschung der Zukunft basiert zunächst auf einem umfassenden Verständnis von Fakten und wissenschaftlichen Grundlagen. Einerseits zeigt sich dabei, welche Einflussfaktoren ein Themenfeld betreffen. Andererseits lassen sich Entwicklungen aus der Vergangenheit oder Gegenwart ableiten. Die Bevölkerungsentwicklung oder die Lebenserwartung können beispielsweise auf zehn bis 20 Jahre, teilweise auch mehr, projiziert werden. Wenn es aber darum geht, das zukünftige Potenziale von Technologien zu bestimmen, fehlen saubere Grundlagen. Hier kann es helfen, mit Szenarien zu arbeiten, die eine höhere oder tiefere Eintreffenswahrscheinlichkeit haben. Dabei liegt das Ziel der Forschung nicht darin, eine präzise Prognose zu erstellen sondern sich Gedanken darüber zu machen, was die Folgen wären, wenn eine Entwicklung eintreffen würde. Man kann sich so auf eine mögliche Zukunft für die Menschen und die Gesellschaft einstellen. Für W.I.R.E. ist es darum nicht das Ziel, allgemeingültige Detailprognosen aufzustellen, das wäre weder machbar noch seriös. Wir möchten dazu beitragen, dass sich Unternehmen, Organisationen oder Menschen mit der Zukunft beschäftigen und ihre eigene Vorstellung darüber entwickeln, wie diese aussehen sollte. Wir helfen dabei, Fakten und Argumente zu finden, um Entscheidungen bestmöglich zu unterstützen und Entwicklungen abzusehen, bei denen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen, dass sie eintreffen. Bei erhöhter Unsicherheit helfen wir durch Inspiration, aber auch mit kritischem Denken dabei, eine eigene Einschätzung zu finden. Das ist die Grundlage für die Gestaltung der Zukunft, die letztendlich im Mittelpunkt unserer Arbeit steht.