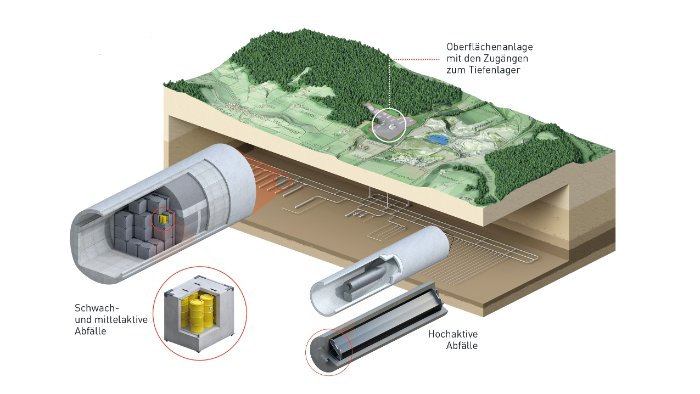Harald Jenny, warum ist die Tiefenlagerung hochradioaktiver Abfälle keine Lösung für unser Atommüll-Problem?
Die Frage kann ich sehr schnell und klar beantwortet: Es ist nicht möglich, sämtliche radioaktiven Stoffe über sehr lange Zeiträume einzuschliessen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Eidgenössischen Nuklearsicherheits-inspektorats (ENSI), die durch die Berechnungen der Nagra selbst bestätigt wird. Diese Erkenntnis spricht fundamental gegen die Tiefenlagerung von Abfällen aus der Kernenergie. Nach circa 10'000 Jahren kommt es demnach beim geplanten Tiefenlager zur Freisetzung von toxischem, radioaktivem Material in die Biosphäre. Mit anderen Worten: Durch die Tiefenlagerung lösen wir nicht ein Problem für künftige Generationen, wir schaffen eines. Und erst noch ein Grosses.
Wie riskant ist das Lagern hochradioaktiver Abfälle in einem Tiefenlager denn konkret?
Gegen Risiken kann man vieles unternehmen. Das wird bei der Planung des Tiefenlagers auch getan. Aber der Austritt von Material nach 10'000 Jahren stellt kein Risiko dar, sondern eine Gewissheit. Darum ist es eine Frage der Ethik und Moral, ob man eine Lösung mit solchem Ausgang künftigen Generationen wirklich zumuten darf. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir tausenden von Generationen nach uns radioaktive Abfälle hinterlassen wollen
Die Menge, die in 10'000 Jahren freigesetzt werden wird, ist so minim, dass sie den vom Bundesrat vorgegebenen maximalen Grenzwert um den Faktor 1000 unterschreitet.
Der Grenzwert ist aber willkürlich von uns festgesetzt. Schauen Sie sich die aktuelle Diskussion rund um die PFAS-Belastung* im Trinkwasser an. Hier will der Bund die Grenzwerte jetzt verschärfen. Solche Grenzwerte sind nicht in Stein gemeisselt. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, ob wir tausenden von Generationen nach uns zumuten können, dass zu deren Lebzeiten radioaktives und toxisches Material in die Biosphäre gelangt und sich im Lebensraum ansammeln kann. Ich bin klar der Meinung, dass wir das nicht tun sollten.
*Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen