Es freut uns, dass wir unser Energiecontracting-Modell vermehrt im grösseren Massstab anwenden dürfen
Martin Nicklas, Leiter Energiecontracting EKZ
Umfassende Energiesysteme für maximale Effizienz
Die ambitionierten energetischen Vorgaben für den Schweizer Gebäudepark bringen grosse Herausforderungen mit sich - für Immobilienprofis und Grossunternehmer gleichermassen. Denn die angestrebte erneuerbare Energiewelt der Zukunft ist komplex. Sie birgt aber auch grosse Chancen, durch die die Verantwortlichen, richtig beraten, nicht nur Geld sparen, sondern auch einen wertvollen Beitrag an die Umwelt leisten können.
EKZ reduziert die Komplexität
Denn neue Sorglos-Modelle zur Integration erneuerbarer Energiesysteme befreien Immobilienfachleute von Aufwand und Risiken. Gleichzeitig erschliessen sie alle Vorteile erneuerbarer Technologien mühelos. Energiecontracting-Kunden von EKZ erhalten Wärme, Kälte, Brauchwarmwasser und Strom als Dienstleistung - ohne dass sie eigene Gebäudetechnikanlagen konzipieren, finanzieren, umsetzen oder betreiben müssen.




.jpg)

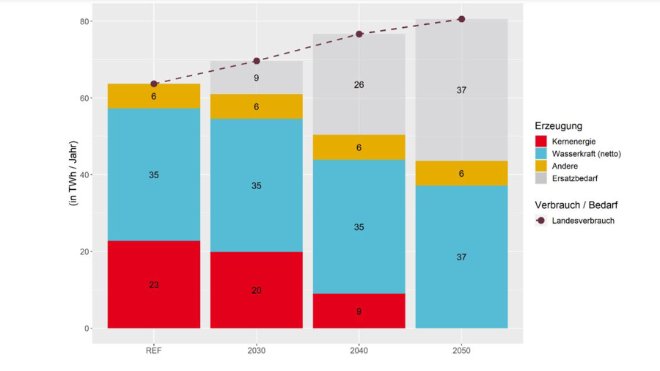





.jpg)


